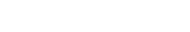Südeuropa
„Eckkneipe „Bar.Leo““
Es gibt sie zum Glück noch. Die Eckkneipen, in denen man einfach reingeht, ohne sich „schick“ machen zu müssen und ein Bier trinkt, weil man einfach Durst hat. Wo man Leute trifft, mit denen man ein paar Worte wechseln kann. Aber viele dieser Treffpunkte sind leider verschwunden.
Warum eigentlich und wie war das so in einer Kneipe ?
Einige Rückblicke dazu etwas weiter unten...
…...
Die Eckkneipe
Die im Foto gezeigte Kneipe kann überall in ähnlicher Form sein. Hier habe ich sie im Stadtteil „El Born“ von Barcelona gesehen, wo früher die Fischer wohnten und arbeiteten. Einfach, aber urig eingerichtet. Wie man erkennen kann haben auch hier die Fischer und andere Einheimische aus dem Viertel gerne nach getaner Arbeit gesessen. Manche sicherlich bis tief in die Nacht.
Allerdings konnte man früher noch in den Kneipen rauchen. Da war so mancher Weitblick bis hin zur Theke stark getrübt, wenn Zigaretten und Zigarren um die Wette qualmten. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
Heutzutage kommen aber auch andere Landsleute und einige Touristen aus fremden Ländern in diese Kneipen hinzu. Dadurch verändert sich die Atmosphäre und der Ablauf innerhalb der Kneipe. Aber wie war das denn vorher ?
Die Recherche darüber war auch für mich wieder sehr interessant. Beim nächsten Kneipenbesuch werden mir sicherlich wieder einige Anekdoten daraus einfallen, die lustig waren oder nachdenklich machen.
Die Magie der Eckkneipe
Die Älteren werden sich erinnern: Peter Alexander sang schon 1975 fast wehmütig von der “Kleinen Kneipe in unserer Straße” – da, wo seiner Meinung nach, das Leben noch lebenswert war. Er beschreibt in dem Song – zugegeben vielleicht ein wenig verklärt – einen Ort, an dem die Breite der Gesellschaft zusammenkommt, Hintergrund und Herkunft wenig zählt, an dem Begegnung mit anderen leicht fällt.
Woher kommt das Wort „Kneipe“ denn in der deutschen Sprache ?
Die Bezeichnung ist eine Verkürzung des Begriffs Kneipschenke, die bereits im 18. Jahrhundert existierte. Dabei handelte es sich um Räumlichkeiten, die so eng waren, dass die Gäste zusammengedrückt sitzen mussten. Das im Mitteldeutschen belegte Verb kneipen steht für „zusammendrücken“.
Einrichtung und Kneipenbetrieb.
Typisch für Kneipen ist der Ausschank von Fassbier am Tresen, an welchem Gäste häufig sitzen können. Im Gastraum befinden sich dann weitere Tische und Stühle. Teilweise gehören zur Einrichtung einer Kneipe auch Spielgeräte wie Billardtische, Kicker, Dartscheiben, Flipper oder Spielautomaten. Viele Kneipen haben auch Fernsehgeräte, in denen beispielsweise Fußballspiele öffentlich gezeigt werden. In einigen Kneipen hängt ein Sparschrank, in den Mitglieder lokaler Sparklubs regelmäßig Bargeld stecken. Kneipen dienen häufig zudem als Treffpunkte anderer Vereine, die dort einen regelmäßigen Stammtisch abhalten. Manchmal finden sich daher in den Kneipen Objekte, die diesen Vereinen gehören oder auf ihre Tätigkeiten verweisen wie etwa Vereinsfahnen oder Pokale. Zu manchen Kneipen gehört auch ein von der eigentlichen Gaststube getrennter, separater Raum oder Saal der für Vereinstreffen oder Familienfeiern vermietet wird.
Die Kneipe war für die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert ein wichtiger Schutzraum und während des Sozialistengesetzes ein zentraler politischer Raum. Ein Ort des Alkoholkonsums war die Kneipe auch stets. Die Öffnungszeiten von Kneipen wurden vielfach durch eine lokal gültige Sperrstunde geregelt, die jedoch in vielen Ländern wieder abgeschafft wurde.
Infolge des Ersten Weltkrieges und der Deutschen Inflation lebten in Arbeitervierteln etwa in Berlin zunehmend zahlreiche Zugewanderte, Arbeits- und Obdachlose. Um den Auflagen und regulären Polizeikontrollen in offiziellen Asylen und Obdachlosenheimen zu entgehen, übernachteten viele „Eheleute, Liebesleute, die sich nicht trennen wollen – zu Spätkommende... – Lichtscheue, die der Polizei aus dem Weg gehen“ in damals sogenannten Penner- oder Pennkneipen. Diese verfügten meist über einen kleinen Vorraum und ein unbeleuchtetes größeres Hinterzimmer mit Stühlen, Bänken oder Sesseln, wo man schlief oder döste. In einigen dieser Kneipen wurde früh morgens nach „Asylschluss“ mit verschiedenen Waren wie Kleidung, Kartoffeln, Brot oder Schnaps gehandelt.
Mit dem Wachstum der Kneipenlandschaft und dem Wachstum einer Stadt übernahmen die Lokale wichtige Funktionen im Zusammenleben der Menschen. Schon in der Vorindustriellen Zeit, bevor es so etwas wie ein Rathaus gab, trafen sich die Amtsmänner in Gastwirtschaften, um hier über die politischen Angelegenheiten der Gemeinde zu entscheiden. Später waren Kneipen Treffpunkte der Arbeiterbewegung und Orte der Politisierung. Wirte waren oft gut informiert und ebenso gut vernetzt. Da überrascht es nicht, dass gleich zwei Bürgermeister ihren beruflichen Hintergrund im Schankgewerbe hatten.
Seit Ende des 20. Jahrhunderts ist in einigen Ländern die Tendenz zu erkennen, dass die Anzahl der Kneipen und traditionellen Gaststätten kontinuierlich zurückgeht. Spitzenreiter des Kneipensterbens war zeitweise Hamburg, wo die Zahl der Gaststätten zwischen 2001 und 2010 um 48,1 Prozent gesunken ist, gefolgt von Niedersachsen mit einem Verlust von 41,2 Prozent.Das hat mehrere Gründe: Die Menschen trinken seit den 1970er Jahren weniger Bier, und junge Menschen verleben ihre Freizeit anders.
Seitdem konnte man eine Veränderung von Kneipen feststellen – weniger „Thekensitzer“, größere Getränkeauswahl und Speisekarten, die mehr bieten als eine Frikadelle. Die rein quantitativen Fakten sprechen für sich. Heute gibt es 54% weniger Kneipen als vor 20 Jahren. Der Verlust ist in der Fläche zu spüren – wenn Gastronomie auftaucht, dann oft geballt an einem Ort. Und Covid-19 hat den Prozess verstärkt – aber nicht allein bedingt. Die Gründe dafür sind vor allen Dingen zwei technische Geräte. Der Kühlschrank und der Fernseher. Während der Kühlschrank für die einfache Verfügbarkeit von Bier im eigenen Haushalt steht, symbolisiert der Fernseher ein verändertes Freizeitverhalten, das vor allen Dingen in den eigenen vier Wänden stattfindet.
All das führt dazu, dass ein Zapfhahn allein die Massen nicht mehr in die Kneipe lockt. Es braucht ein besonderes Angebot und Erlebnisse, die über das gezapfte Bier hinausgehen. Die Ansprüche an das kulinarische Angebot, die Einrichtung und das kulturelle Programm sind gestiegen. Dazu kommt, dass die klassische Eckkneipe ein weiteres Problem bekam, als Außengastronomiekonzepte groß wurden. Die Erkenntnisse über die Negativ-Faktoren für die Kneipe hat man vor allen Dingen aus explorativen Interviews mit vielen Gastwirten aus ganz Deutschland gewonnen. Diese haben auch bestätigt, dass die Corona-Pandemie neben veränderten Verhaltensweisen, wie z.B. auch einem erhöhten Gesundheitsbewusstsein und der Entstehung von Systemgastronomen auf der grünen Wiese ein entscheidender Faktor für viele Kneipenschließungen war.
Aber es gibt auch gute Gründe für Menschen und Kommunen, ihre Kneipen zu unterstützen. Sie stärken sie die lokale Identität und sind ein Wirtschaftsfaktor in der lokalen Ökonomie mit hohen Kopplungseffekten mit anderen Wirtschaftszweigen. Gerade in Großstädten ist Gastronomie ein Standortfaktor für die Anwerbung bestimmter Berufsgruppen und es zeigt sich, dass die Gastrolandschaft einen hohen Einfluss auf die Wohnortwahl hat.
Das Wichtigste an der Kneipe ist die überraschende Begegnung mit Menschen, die man sonst nie getroffen hätte. Damit trägt jeder Tresen zu einer offenen, vielfältigen Gesellschaft bei, in der Menschen im Austausch sind.
...und noch etwas...
Die Redewendung „eine Kneipentour machen“ bezeichnet den mit entsprechendem Alkoholkonsum einhergehenden Besuch mehrerer Kneipen nacheinander. Dabei wird gelegentlich unterstellt, dass der Gast wegen seiner Trunkenheit oder weil er nicht zahlen konnte aus einer Kneipe herausgeworfen wurde und deshalb eine andere aufsucht. In diesem Sinne, Prost!
(Quelle: teilweise Wickipedia)
Somit – nicht alles verlief nur harmonisch in einer Kneipe. So wie im richtigen Leben.
Warum eigentlich und wie war das so in einer Kneipe ?
Einige Rückblicke dazu etwas weiter unten...
…...
Die Eckkneipe
Die im Foto gezeigte Kneipe kann überall in ähnlicher Form sein. Hier habe ich sie im Stadtteil „El Born“ von Barcelona gesehen, wo früher die Fischer wohnten und arbeiteten. Einfach, aber urig eingerichtet. Wie man erkennen kann haben auch hier die Fischer und andere Einheimische aus dem Viertel gerne nach getaner Arbeit gesessen. Manche sicherlich bis tief in die Nacht.
Allerdings konnte man früher noch in den Kneipen rauchen. Da war so mancher Weitblick bis hin zur Theke stark getrübt, wenn Zigaretten und Zigarren um die Wette qualmten. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
Heutzutage kommen aber auch andere Landsleute und einige Touristen aus fremden Ländern in diese Kneipen hinzu. Dadurch verändert sich die Atmosphäre und der Ablauf innerhalb der Kneipe. Aber wie war das denn vorher ?
Die Recherche darüber war auch für mich wieder sehr interessant. Beim nächsten Kneipenbesuch werden mir sicherlich wieder einige Anekdoten daraus einfallen, die lustig waren oder nachdenklich machen.
Die Magie der Eckkneipe
Die Älteren werden sich erinnern: Peter Alexander sang schon 1975 fast wehmütig von der “Kleinen Kneipe in unserer Straße” – da, wo seiner Meinung nach, das Leben noch lebenswert war. Er beschreibt in dem Song – zugegeben vielleicht ein wenig verklärt – einen Ort, an dem die Breite der Gesellschaft zusammenkommt, Hintergrund und Herkunft wenig zählt, an dem Begegnung mit anderen leicht fällt.
Woher kommt das Wort „Kneipe“ denn in der deutschen Sprache ?
Die Bezeichnung ist eine Verkürzung des Begriffs Kneipschenke, die bereits im 18. Jahrhundert existierte. Dabei handelte es sich um Räumlichkeiten, die so eng waren, dass die Gäste zusammengedrückt sitzen mussten. Das im Mitteldeutschen belegte Verb kneipen steht für „zusammendrücken“.
Einrichtung und Kneipenbetrieb.
Typisch für Kneipen ist der Ausschank von Fassbier am Tresen, an welchem Gäste häufig sitzen können. Im Gastraum befinden sich dann weitere Tische und Stühle. Teilweise gehören zur Einrichtung einer Kneipe auch Spielgeräte wie Billardtische, Kicker, Dartscheiben, Flipper oder Spielautomaten. Viele Kneipen haben auch Fernsehgeräte, in denen beispielsweise Fußballspiele öffentlich gezeigt werden. In einigen Kneipen hängt ein Sparschrank, in den Mitglieder lokaler Sparklubs regelmäßig Bargeld stecken. Kneipen dienen häufig zudem als Treffpunkte anderer Vereine, die dort einen regelmäßigen Stammtisch abhalten. Manchmal finden sich daher in den Kneipen Objekte, die diesen Vereinen gehören oder auf ihre Tätigkeiten verweisen wie etwa Vereinsfahnen oder Pokale. Zu manchen Kneipen gehört auch ein von der eigentlichen Gaststube getrennter, separater Raum oder Saal der für Vereinstreffen oder Familienfeiern vermietet wird.
Die Kneipe war für die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert ein wichtiger Schutzraum und während des Sozialistengesetzes ein zentraler politischer Raum. Ein Ort des Alkoholkonsums war die Kneipe auch stets. Die Öffnungszeiten von Kneipen wurden vielfach durch eine lokal gültige Sperrstunde geregelt, die jedoch in vielen Ländern wieder abgeschafft wurde.
Infolge des Ersten Weltkrieges und der Deutschen Inflation lebten in Arbeitervierteln etwa in Berlin zunehmend zahlreiche Zugewanderte, Arbeits- und Obdachlose. Um den Auflagen und regulären Polizeikontrollen in offiziellen Asylen und Obdachlosenheimen zu entgehen, übernachteten viele „Eheleute, Liebesleute, die sich nicht trennen wollen – zu Spätkommende... – Lichtscheue, die der Polizei aus dem Weg gehen“ in damals sogenannten Penner- oder Pennkneipen. Diese verfügten meist über einen kleinen Vorraum und ein unbeleuchtetes größeres Hinterzimmer mit Stühlen, Bänken oder Sesseln, wo man schlief oder döste. In einigen dieser Kneipen wurde früh morgens nach „Asylschluss“ mit verschiedenen Waren wie Kleidung, Kartoffeln, Brot oder Schnaps gehandelt.
Mit dem Wachstum der Kneipenlandschaft und dem Wachstum einer Stadt übernahmen die Lokale wichtige Funktionen im Zusammenleben der Menschen. Schon in der Vorindustriellen Zeit, bevor es so etwas wie ein Rathaus gab, trafen sich die Amtsmänner in Gastwirtschaften, um hier über die politischen Angelegenheiten der Gemeinde zu entscheiden. Später waren Kneipen Treffpunkte der Arbeiterbewegung und Orte der Politisierung. Wirte waren oft gut informiert und ebenso gut vernetzt. Da überrascht es nicht, dass gleich zwei Bürgermeister ihren beruflichen Hintergrund im Schankgewerbe hatten.
Seit Ende des 20. Jahrhunderts ist in einigen Ländern die Tendenz zu erkennen, dass die Anzahl der Kneipen und traditionellen Gaststätten kontinuierlich zurückgeht. Spitzenreiter des Kneipensterbens war zeitweise Hamburg, wo die Zahl der Gaststätten zwischen 2001 und 2010 um 48,1 Prozent gesunken ist, gefolgt von Niedersachsen mit einem Verlust von 41,2 Prozent.Das hat mehrere Gründe: Die Menschen trinken seit den 1970er Jahren weniger Bier, und junge Menschen verleben ihre Freizeit anders.
Seitdem konnte man eine Veränderung von Kneipen feststellen – weniger „Thekensitzer“, größere Getränkeauswahl und Speisekarten, die mehr bieten als eine Frikadelle. Die rein quantitativen Fakten sprechen für sich. Heute gibt es 54% weniger Kneipen als vor 20 Jahren. Der Verlust ist in der Fläche zu spüren – wenn Gastronomie auftaucht, dann oft geballt an einem Ort. Und Covid-19 hat den Prozess verstärkt – aber nicht allein bedingt. Die Gründe dafür sind vor allen Dingen zwei technische Geräte. Der Kühlschrank und der Fernseher. Während der Kühlschrank für die einfache Verfügbarkeit von Bier im eigenen Haushalt steht, symbolisiert der Fernseher ein verändertes Freizeitverhalten, das vor allen Dingen in den eigenen vier Wänden stattfindet.
All das führt dazu, dass ein Zapfhahn allein die Massen nicht mehr in die Kneipe lockt. Es braucht ein besonderes Angebot und Erlebnisse, die über das gezapfte Bier hinausgehen. Die Ansprüche an das kulinarische Angebot, die Einrichtung und das kulturelle Programm sind gestiegen. Dazu kommt, dass die klassische Eckkneipe ein weiteres Problem bekam, als Außengastronomiekonzepte groß wurden. Die Erkenntnisse über die Negativ-Faktoren für die Kneipe hat man vor allen Dingen aus explorativen Interviews mit vielen Gastwirten aus ganz Deutschland gewonnen. Diese haben auch bestätigt, dass die Corona-Pandemie neben veränderten Verhaltensweisen, wie z.B. auch einem erhöhten Gesundheitsbewusstsein und der Entstehung von Systemgastronomen auf der grünen Wiese ein entscheidender Faktor für viele Kneipenschließungen war.
Aber es gibt auch gute Gründe für Menschen und Kommunen, ihre Kneipen zu unterstützen. Sie stärken sie die lokale Identität und sind ein Wirtschaftsfaktor in der lokalen Ökonomie mit hohen Kopplungseffekten mit anderen Wirtschaftszweigen. Gerade in Großstädten ist Gastronomie ein Standortfaktor für die Anwerbung bestimmter Berufsgruppen und es zeigt sich, dass die Gastrolandschaft einen hohen Einfluss auf die Wohnortwahl hat.
Das Wichtigste an der Kneipe ist die überraschende Begegnung mit Menschen, die man sonst nie getroffen hätte. Damit trägt jeder Tresen zu einer offenen, vielfältigen Gesellschaft bei, in der Menschen im Austausch sind.
...und noch etwas...
Die Redewendung „eine Kneipentour machen“ bezeichnet den mit entsprechendem Alkoholkonsum einhergehenden Besuch mehrerer Kneipen nacheinander. Dabei wird gelegentlich unterstellt, dass der Gast wegen seiner Trunkenheit oder weil er nicht zahlen konnte aus einer Kneipe herausgeworfen wurde und deshalb eine andere aufsucht. In diesem Sinne, Prost!
(Quelle: teilweise Wickipedia)
Somit – nicht alles verlief nur harmonisch in einer Kneipe. So wie im richtigen Leben.
|
|
Um einen Kommentar zum Bild zu verfassen, musst Du Dich zuerst anmelden oder neu registrieren!